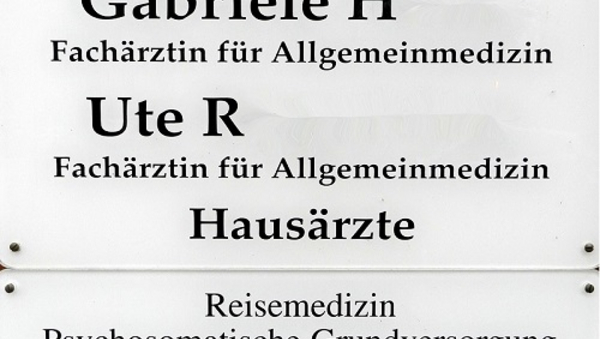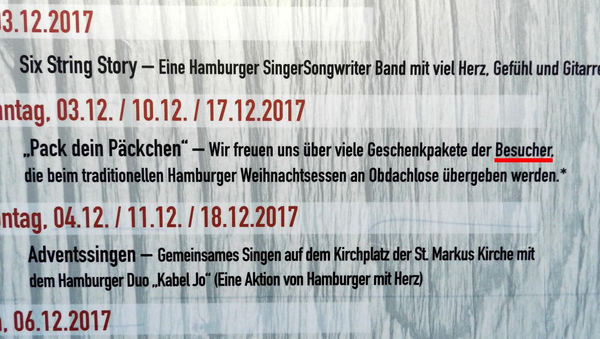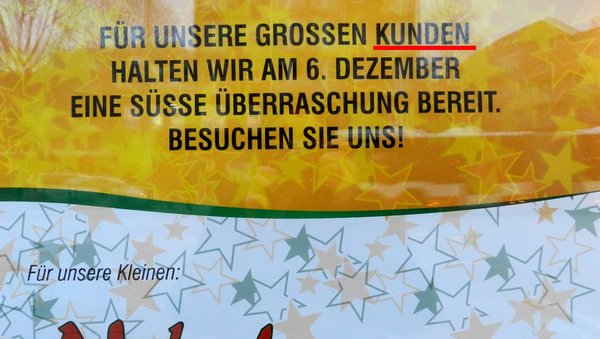Interview | "Die Relevanz von Geschlecht nimmt ab"
Die Debatte um geschlechtergerechte Sprache hat in Deutschland kein leichtes Los. Gerne wird sie pauschal diskreditiert, indem man sich mit absurden Beispielen wie dem Gendern von unbelebten Objekten ("die Kugelschreiberin") über sie lustig macht. Die wissenschaftlichen Hintergründe spielen dabei selten eine Rolle.
An der Uni Mainz forscht Prof. Dr. Damaris Nübling seit Jahren zu geschlechtergerechter Sprache. Sie gilt als renommierte Sprachexpertin in den Bereichen Namenforschung und Genderlinguistik. Unter anderem untersucht sie die Relevanz von Namen zur Herstellung von Geschlecht, den Wandel von Frauenbezeichnungen oder das sprachliche Verhältnis von Genus, Sexus und Gender – also dem grammatischen, biologischen und sozialen Geschlecht von Substantiven. Darüber sprach sie auch im Interview mit Campus Mainz.
Die Sprachwissenschaft ist die "Meteorologie der Geisteswissenschaften"
CM: Frau Nübling, wenn in den Medien über geschlechtergerechte Sprache debattiert wird, geht es eher spöttisch als sachlich zu. Haben Sie eine Erklärung, woran das liegt?
Prof. Dr. Nübling: Das würde ich Sie gerne fragen. Die Linguistik wird in den Medien überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, obwohl sie mittlerweile einiges dazu erforscht hat. Ich denke, das liegt am Fach. Manche bezeichnen die Sprachwissenschaft als die "Meteorologie der Geisteswissenschaften": Alle reden über das Wetter und halten sich für Meteorologen. Ähnlich ist es mit der Sprache: Alle sprechen Deutsch und halten sich für Germanisten. Manche verstehen nicht einmal, warum es eine Fachdisziplin dahinter gibt.
Außerdem stimmen die Forschungsergebnisse der Linguistik nicht immer mit dem subjektiven Sprachempfinden überein. Das führt zu Abwehrreaktionen, weil Sprache Teil unserer Identität ist.
Generell werden im Deutschen jegliche sprachliche Veränderungen kategorisch abgelehnt – seien es die Rechtschreibreformen, Anglizismen, Sprachwandel oder eben die geschlechtergerechte Sprache. Letzteres umso mehr, weil es da auch um die Aufgabe von Privilegien geht. Die medial vermittelte männliche Sicht auf die Sprache ist noch sehr dominant, frei nach dem Motto: "Ihr bekommt so viel, wie wir für richtig halten und wenn mehr gefordert wird, dann wird es lächerlich gemacht." Man denke nur an die Einführung des generischen Femininums an den Unis Potsdam und Leipzig. Einige Erfolge wurden bereits erzielt, doch immer sehr kleinschrittig und mit großem Getöse wie zum Beispiel bei der Abschaffung der Anrede "Fräulein". Heute trauert der niemand mehr nach.
Man könnte die Komplexität der linguistischen Forschung – so gut es geht – vereinfachen, sodass es auch der Nicht-Germanist und die Nicht-Germanistin verstehen.
Auf jeden Fall! Ich gebe auch mein Bestes, damit ich verstanden werde, aber natürlich erfordert es auch etwas Energie von Zuhörerseite. Beispielsweise kommt in der deutschen Gender-Debatte oft die Forderung "Macht es doch wie im Englischen!". Man kann die Sprachen nicht miteinander vergleichen, weil das Deutsche ein Drei-Genus-System hat ("der", "die", "das") und das Englische gar kein nominales Genus, es gibt nur "the" und "a". Das Genus, also das grammatische Geschlecht, ist eng mit dem persönlichen Geschlecht verknüpft. Dieses Problem stellt sich im Englischen also nicht.
Im Zuge der Gleichberechtigungsdebatte zwischen Frau und Mann wird in der Arbeitswelt viel über die sogenannte Frauenquote diskutiert, weil Frauen vor allem in höheren Positionen unterrepräsentiert sind. Wie präsent sind Frauen in unserer Sprache?
Frauen sind auch in der Sprache noch weit unterrepräsentiert. Das gilt zumindest in der geschriebenen Sprache als gesichert. Frauen werden in der Presse nur zu circa 20 Prozent thematisiert, Männer zu 80 Prozent. Die Tendenz ist leicht steigend, vor 10 bis 15 Jahren waren es noch 15 Prozent. Wenn man genauer hinschaut, wird zudem deutlich, dass die Frau dabei oft in einer passiven Rolle, oft sogar als Opfer präsentiert wird und selten als handlungsmächtiges Individuum wie zum Beispiel als Politikerin oder Wissenschaftlerin in Erscheinung tritt.
Die Mär vom "generischen Maskulinum"
Wir verwenden tagtäglich das sogenannte "generische Maskulinum", also die männliche, verallgemeinernde Form, die sich sowohl auf Männer als auch auf Frauen beziehen soll. Zum Beispiel: "Der Mainzer Student lebt und lernt auf dem Campus." Kann sich der Sprecher die weibliche Form nicht einfach dazudenken?
Nein, weil das generische Maskulinum nachgewiesenermaßen die männliche Vorstellung viel stärker hervorruft, als es beabsichtigt ist. Es gibt ein Ungleichgewicht zwischen Produzenten und Rezipienten: Mag sein, dass "der Student" und "die Studentin" gleichermaßen gemeint sind, das kommt aber nicht beim Gegenüber an. Rezipiententests haben erwiesen, dass hier die männliche Vorstellung klar dominiert. Deshalb sprechen wir vom pseudo-generischen Maskulinum. Es ist aber auch richtig, dass die Frau beim "generischen Maskulinum" nicht zwangsläufig völlig ausgeschlossen sein muss.
Es macht auch einen Unterschied, ob man von "dem Studenten" im Singular oder "den Studenten" im Plural spricht. Im Plural ist das "generische Maskulinum" etwas entschärft, weil es in diesem Fall nirgends im Satz ein erkennbares Genus gibt. Auch hier dominiert zwar die männliche Vorstellung, jedoch nicht so stark wie im Singular.
Hinzu kommt der Faktor des sozialen Geschlechts: "Einwohner" oder "Leser" sind etwas weniger heikle Fälle, da diese Personengruppen in der Regel tatsächlich etwa zur Hälfte aus Männern und zur Hälfte aus Frauen bestehen. Schwieriger wird es beim "Politiker" oder beim "Professor": Würde man Leute bitten, "Politikern" oder "Professoren" Namen zu geben oder sie zu malen, dann kämen dabei mehr Männer heraus, als es anteilig Männer unter den Professorinnen und Professoren oder Politikerinnen und Politikern gibt.
"Feste Rezepte gibt es nicht, Kreativität ist gefragt"
Welche Überlegungen gibt es in der Genderlinguistik, wie man diesem Problem begegnen kann?
Da gibt es viele. Die Beidnennung ("ein Student oder eine Studentin") oder die Schreibung mit Schrägstrich ("ein/-e Student/-in") sind aufwändig. Ich persönlich verwende oft die Binnenmajuskel ("StudentIn"), die sich schon ziemlich stark durchgesetzt hat und auch elegant und ökonomisch ist.
Immer häufiger sehe ich sogenannte Streumaskulina und Streufeminina. Diese Methode finde ich immer besser. Sie wird auch gerne von meinen männlichen Kollegen in ihren Texten genutzt. Dabei spricht man einmal von "Fußgängerinnen", dann von "Lesern", dann wieder von "Römerinnen" und anschließend von "Autofahrern". Das Mischen löst am Anfang Irritationen aus, denn wir sind es nicht gewohnt, dass sich im Umkehrschluss generische Feminina auch auf Männer beziehen sollen. Aber spätestens ab der dritten Seite gibt man die Fixierung auf das Geschlecht auf. Wenn man den Leuten sozusagen das Geschlecht um die Ohren haut, dann verliert es an Relevanz. Natürlich gilt das nur beim generischen Gebrauch – beim spezifischen Bezug auf Einzelpersonen sollte man das Geschlecht kenntlich machen.
Langfristig wäre es gut, die Kategorie Geschlecht aufzulösen, statt sie zu dramatisieren. Das funktioniert neben dem Streuen auch mit neutralisierenden Pronomen im Plural wie "alle", "viele" oder "manche". Außerdem kann man auch anstelle von Personenbezeichnungen abstraktere Begriffe verwenden, zum Beispiel: "Das Institut hat entschieden" anstelle von "Der Institutsleiter hat entschieden" und so weiter.
Allerdings kommt das immer auf den Kontext an. Feste Rezepte gibt es nicht, Kreativität ist gefragt. Dazu gehören auch die zunehmenden Präsenspartizipien im Plural wie "Studierende". Singulare wie "der Studierende" taugen dagegen nicht, da Singulare immer mit Genus aufgeladen sind. Meine Erfahrung ist, dass es weniger eine Frage der Möglichkeiten als des Willens ist.
Geschlecht wird immer irrelevanter
Also wird unsere Konzeption von Geschlecht eines Tages einfach in der Versenkung der Bedeutungslosigkeit verschwinden? Oder ist das eher Wunschdenken?
Die Relevanz von Geschlecht nimmt schon jetzt ab, auch wenn das Ziel noch weit entfernt erscheint. Denken Sie an viele Tätigkeiten, Berufe und Kleidungsstücke wie die Hose, die bereits nicht mehr mit einem bestimmten Geschlecht in Verbindung gebracht werden. Auch in der Familie ist es zunehmend egal, ob der Mann oder die Frau das Kind wickelt. Männer ziehen sich Ohrringe an, was früher ein exklusives Weiblichkeitsmerkmal war. Früher wurden Frauen und Männer noch räumlich getrennt, zum Beispiel in der Kirche, heute trifft das nur noch auf Toiletten zu. Und selbst diese Trennung wird langsam aufgehoben: Heute gibt es so viele Unisex-Toiletten wie noch nie. In Schweden gehören sie schon zum Alltag.
Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Namengebung wider: Männliche Vornamen nähern sich immer weiter an den Klang von weiblichen Vornamen an. Im Jahr 2000 kamen mit Noah und Luca Männernamen auf -a erstmals in die Top 10. Wären solche Namen vor 30 oder 40 Jahren in Deutschland aufgekommen, wären sie noch zu Frauennamen geworden, da die a-Endung bis vor 2000 schlicht nur bei Frauennamen vorkam. Eltern verfolgen bei der Namengebung andere Ziele als die Auflösung der Geschlechter, deshalb ist das eine sehr interessante Entwicklung.
Sie können den Relevanzverlust von Geschlecht mit Religion vergleichen. Der Glaube an Religion löst sich — zumindest in Europa — auch immer weiter auf. Das erreicht man nicht, indem man sprachlich ständig zehn Glaubensrichtungen und Splittergruppen aktiviert, sondern indem es egal wird, ob jemand katholisch oder evangelisch oder sonstwas ist. Früher galt eine evangelisch-katholische Ehe noch als "Mischehe", heute spielt die Konfession kaum noch eine Rolle. Das ist auch das langfristige und einzig richtige Ziel der Geschlechterunterscheidung, egal wie viele man konkret unterscheidet.
Wohlwollen ist bei geschlechtergerechter Sprache Voraussetzung
Ob gesprochen oder geschrieben: konsequentes Gendern ist anstrengend und ein Ding der Unmöglichkeiten – selbst, wenn man will. Diesen Vorwurf hört man immer wieder. Wie würden Sie darauf eingehen?
Dass man es im Gesprochenen immer durchhält, ist äußerst schwierig. Das darf man auch nicht verlangen und kritisieren. Man sollte aber immer wieder beide Geschlechter nennen. Ich denke, Teilschritte in die richtige Richtung sind mehr, als sofort alles zu verlangen.
Wenn man zur Kenntnis nimmt, dass das "generische Maskulinum" eine männliche Vorstellung befördert, dann hat man schon viel verstanden. Die meisten streiten ja ab, dass es überhaupt ein Problem gibt. Wir haben mittlerweile 15 bis 20 psycholinguistische Untersuchungen, die mit verschiedenen Methoden absolut standardkonform an das Problem herangegangen sind und alle in die gleiche Richtung weisen: Das "generische Maskulinum" funktioniert nicht. Es hat eine starke männliche Schlagseite. Deutlich ausgeglichener werden Texte mit Binnenmajuskel oder einer Form der Beidnennung verstanden.
In Dokumenten liest man öfter mal: "Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet". Ist man damit dann fein raus?
Nein. Diesen Kommentar nennt man "Legitimationsformel" und er schützt wie gesagt nicht vor der Verwechslung von "neutral gemeinten" Maskulina mit geschlechtsspezifischen. Artikel über Professoren enthalten plötzlich Verweise auf deren Rolle als Väter – solche Verstöße gegen die beabsichtigte Geschlechtsneutralität finden sich auch in Texten mit Legitimationsformel zuhauf. Und selbst wenn solche Verwechslungen von Schreiberseite nicht vorkommen, spätestens leserseitig werden solche Texte mehrheitlich männlich interpretiert. Geglückte Kommunikation liegt nur dann vor, wenn das, was gemeint ist, auch so verstanden wird. Dem ist aber trotz Legitimationsformel nicht so.
Achten Sie immer auf geschlechtergerechte Sprache?
Sie werden es ja bemerkt haben: Im Gesprochenen kann auch ich es nicht immer durchhalten. Ich habe eben zum Beispiel von "Rezipienten" gesprochen. In schriftlichen Texten achte ich viel mehr darauf. Ich bin gegen dogmatische Ein-Rezept-Methoden und nutze eine Kombination aus Streumaskulina und -feminina, Binnenmajuskeln und pluralischen Pronomen vom Typ "alle", "manche".
Welchen Rat geben Sie Studierenden auf den Weg, wenn die nächste Hausarbeit ansteht?
Ich bin schon froh, wenn meine Studierenden auf den Vornamen der WissenschaftlerInnen achten und nicht alle mit "er" pronominalisieren. Ich mache keine strikten Vorgaben, aber ich spreche das Problem natürlich an. Die Legitimationsformel mögen die meisten Studierenden sehr gerne, die möchte ich allerdings nicht sehen. Generell ist die Abwehr auch unter den Studierenden erstaunlich hoch und die Kenntnis sehr gering. Letztendlich muss man das für sich selbst entscheiden. Die Bereitschaft muss schon da sein – Zwang von außen bringt nicht viel. Ich setze auf Aufklärung.
Frau Nübling, vielen Dank für das Interview.
Campus Mainz e.V. unterstützen!
Campus Mainz e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und die meiste Arbeit ist ehrenamtlich. Hilf uns dabei auch in Zukunft tolle Dienste für alle kostenlos anzubieten. Unterstütze uns jetzt!